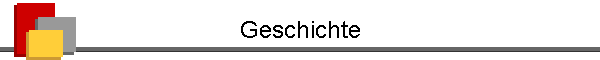|

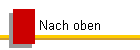
| |
Die Geschichte von Stockhausen aus Wikipedia (Danke an Werner Krömmelbein)
Stockhausen-Herbstein
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Stockhausen-Herbstein ist ein Dorf im
Vogelsbergkreis in
Hessen.
Hier befindet sich der älteste Dorfkindergarten im ehemaligen
Großherzogtum Hessen-Darmstadt.

Luftbild von Peter Möller

Luftbild von Peter Möller
Geografische Lage
Stockhausen liegt am Osthang des
Vogelsberges, 20 km westlich von
Fulda. Es
liegt in 300m Höhe und hat ca. 900 Einwohner. Die Größe von Stockhausen
beträgt 17,7 km².
Vorgeschichte
- Es ist schon über 1100 Jahre her, dass Stockhausen erstmalig erwähnt
wird. Wann diese Siedlung erstanden ist, ist unbekannt, jedoch zeugen
von Jahrtausendealter menschlicher Kultur die
Hügelgräber, die sich ringsum und in der Gemarkung zahlreich finden.
Mehrere wurden geöffnet und man fand darin: zwei Lanzenspitzen, eine
Dolchklinge, zwei Spiralnadeln, eine Nadel, ein Diadem und einen
Schlüssel.
- Über die Entstehungszeit der Siedlung Stockhausen kann man
vielleicht etwas aus ihrem Namen schließen. Es gibt verschiedene
Vermutungen; am wahrscheinlichsten lässt sich dies aus der ältesten Form
des Namens "Stockhusen" ableiten: Die ersten Häuser wurden zum Schutz
vor Wölfen und sonstigen wilden Tieren und gegen Überschwemmungen im
sumpfigen Tal, auf hohen Pfosten, also auf Stöcken gebaut. Ähnlich ist
eine andere Auslegung: In der keltischen Zeit vor 500 n. Chr.
baute die keltische Bevölkerung ihre Siedlungen auf die Höhen, da die
Niederungen mit undurchdringlichen Sumpfwäldern bedeckt waren. Die nach
dieser Zeit eindringenden
Germanen, hier die
Chatten,
folgten den Fluss- und Bachtälern, die sie rodeten und urbar machten. So
rodeten jene auch hier die Sumpfwälder und gründeten zum Teil auf den
stehen gebliebenen Baumstöcken ihre Häuser bzw. Siedlung, daher "Stock-Hausen".
- Da die
Chatten
nach 500 n. Chr. hier eindrangen und Stockhausen schon nach
800 n. Chr. urkundlich erwähnt ist, muss es in der so genannten
Fränkischen Epoche gegründet worden sein.
- Schon in sehr alter Zeit war Stockhausen Sitz eines Hochgerichts
oder Blutgerichts, das nicht nur geringe Vergehen ahndete, sondern über
"Hals und Hand" Recht sprach.
- Stockhausen wird erstmals 882 n. Chr. urkundlich genannt.
Chronik
- 882 erstmals urkundlich genannt als Lehen der Abtei
Fulda.
- 1428 Übernahme des Gericht Stockhausen durch die Freiherrn
von
Riedesel.
- 1558 Bau der Hermannburg.
- 1603 Gründung der Freischule.
- 1790 - 1807 Bau des heutigen Schlosses auf den Mauern der
Hermannsburg.
- 1841 Gründung des ersten Dorfkindergarten im ehemaligen
Großherzogtum Hessen-Darmstadt.
- 1846 Bau der heutigen Kirche.
- 1874 Gründung der
Feuerwehr Stockhausen.
- 1880 Gründung der Spar-und Darlehenskasse Stockhausen.
- 1894 Gründung des Gesangsvereins "Germania" als
Männergesangverein.
- 1899 Großbrand im Nord-Ostteil von Stockhausen, es wurden 22
Wohn- und 33 Nebengebäude zerstört.
- 1899 Gründung des Obst und Gartenbauverein Stockhausen.
- 1900 Gründung des gemischten Chores "Germania" Stockhausen.
- 1920 Gründung des Sportvereins Stockhausen.
- 1946 Neugründung des
Sportverein Stockhausen.
- 1972 Eingliederung im Zuge der Gebietsreform in die Stadt
Herbstein.
Wüstungen im Stockhäuser Grund
Vorgeschichte
- Die Gemarkungen Stockhausen, Schlechtenwegen und Schadges gehören z.
T. noch zum Ostvorland des
Vogelsberges, das zur Hälfte von den Vorgelagerten
Bundsandsteinböden gebildet wird. Im Tal von Stockhausen sind mit die
besten Böden ermittelt worden. Eine verhältnismäßig lange
Vegetationsdauer unterscheidet dieses Gebiet ebenfalls vom eigentlichen
Vogelsberg. Während dort die Obstbäume fehlen, sind sie hier in der
geschützten Lage reichlich zu finden. Auch die vorgeschichtlichen Funde
zeigen, dass dieses Gebiet schon in der Vorzeit besiedelt war.
Stockhausen ist dabei der weitaus am günstigsten gelegene Ort. Er war
schon im Mittelalter der größte und lag daher im Interessenbereich
sowohl des Klosters in Blankenau als auch der Junker in Eisenbach. Beide
Parteien hatten dort, wie auch in Schadges, Besitz und als im Jahr
1465 die Fuldisch-Riedeselsche
Fehde (die so genannte
Steinsche Fehde) ausbrach, wurden beide Orte aus diesem Grunde für
neutral erklärt. Über das übrige Land aber tobte der Kampf. Aus den
späteren Klageschriften entnehmen wir, dass dabei die meisten Orte des
Stockhäuser Gerichts zerstört wurden. Das Kloster Blankenau hatte im
Gericht Stockhausen acht Dörfer und Wüstungen besessen: Niedendorf,
Bedelsdorf, Gensdorf, Stockhausen, Schadges, Rixdorf (Rixfeld), Reichlos
und Rippach. Die Wüstungen lagen noch 1534, seit dieser Fehde,
unbewohnt. Der Probst zu Blankenau beschwerte sich in diesem Jahr über
die
Riedesel, denn diese Orte mussten dem Kloster Lehenschaft und
Frondienst leisten, besonders die Waldschmieden zu Schadges und
Stockhausen jährlich zwölf Scharen (Pflugscharen). Die
Riedesel hätten das dem Kloster genommen und auf die Güter Kuh- und
Weinfuhrgeld gelegt. Den Leuten, die die Wüstungen nach Wüstungsrecht
inne hatten, hätten sie befohlen, statt auf die rechten Wohnstätten nun
in Stockhausen zu bauen. Die Wüstung Dankrode habe dem Kloster gehört,
es habe sie an die Leute von Hainzell verliehen. Die
Riedesel hätten aber nach dem bäurischen Aufruhr einen Vikar zu
Blankenau, Michael Pfannschmidt, geschlagen, gefangen genommen , nach
Eisenbach gebracht und dort gezwungen, die Wüstung ihren Untersassen zu
Schlechtenwegen und Stockhausen zu leihen. Später hätten sie die Wüstend
sogar selbst verliehen.
- Wenn wir hier auch nur die Klagen der einen Partei hören, so lernen
wir aus diesen Urkunden doch die Wüstungen des Stockhäuser Grundes und
ihr Schicksal kennen. Die Bewohner, die durch die Kriegsereignisse in
das geschützte Hauptdorf geflüchtet waren, wurden gezwungen, dort zu
bleiben und "dort zu bauen". Wie wir unten sehen werden, brauchten die
Riedesel sie vermutlich, um mit ihnen verlassene Hofstellen in
Stockhausen zu besetzen. Die Blankenau zinsenden Dörfer blieben daher
Wüstungen. Das
Riedeselsche Stockhausen, das durch seine günstige Lage schon vorher
der größte Ort war, ging nun als noch größerer Ort mit erweiterter
Gemarkung aus dem Streit hervor. Da die aufgegebenen Orte
landwirtschaftlich nicht ungünstig gelegen hatten, so sind die Felder
nirgends total verwüstet.
- Die beiden auf Schlechtenweger Gebiet liegenden Wüstungen Dankenrod
und Rißbach reichen mit ihrer Flur in die Stockhäuser Gemarkung hinein
und werden daher auch hier behandelt.
Dankenrod
- 1324 Heinrich IV. Abt zu
Fulda,
bestätigt dem Kloster Blankenau die diesem von seinen Vorgängern
gemachten Schenkungen in Richolffs, Rixfeld, Burkhards, Salzschlirf,
Kirchstockhausen, Gersdorf, Dangkerode, Borsa und Eichenau.
- 1337 Werner v. Blankenwald verkauft den geistlichen Frauen zu
Blankenau eine Hufe in Dankerode, Rindesschenkel geheissen, und die
"Hofstadt uffem Hagen" für 25 Pfund Heller.
- 1383 Metze von Lisberg hat zwei Güter zu Oberndorff und eins
zu Gundolfs vertauscht an Else von Merlau gegen deren beiden Güter in
Dantzinrode (ein Gut, da der alte Holle darauf sitzt und eins, auf
welchem Fritz Scheffer sitzt) und eine halbe Mühle in Risbach. Ferner
wird erwähnt die halbe Mohlnstatt (Mühlstätte) in dem Dorf, Dangkenrod
und das Holz das bei Dangkenrod gelegen ist und die "Hart" heißt.
- 1384 Friedrich Herr zu Lisberg verzichtet auf das Gütchen zu
Dankerode, das seine Mutter von Erhard von Herbstein gekauft hat, um es
dem Altar von Blankenau zu stiften.
- 1405 Rörich von Eisenbach und Anna seine Ehefrau bestätigen
eine Stiftung derer von Lisberg nämlich einer ewigen Vikarie zu
Blankenau zu der jene einen Hof zu Lüder und die Güter zu Dangkenrode
gegeben haben. Sie vermehren diese Stiftung durch das Wasser, die
Fischerei von dem Angewede, da der Bornfloss zu Schlechtenwegen in das
Wasser geht, bis an die Lange Wiese, die man nennt "in der Paltz",
gelegen zwischen Dangkenrode und Rissbach. Bei Landau heißt es außerdem
"Das Fischwasser, die Nente genannt, zwischen Dankerode und Risbach".
- 1524 In diesem Jahre heißt es bei der Landscheidung des
Gerichts Stockhausen: "...vber der Hartt hinaus bis an die Altenhege vnd
further oben hinein zu dem Schlage zwuschen Schlechtenwegen vnd
Dankenrodt vnd von dem Schlage über das Wasser in Weishen Wiesen jn das
Borngen und further uff den Pfadt der dann gehet von
Herbstein ghein Dankenrodt, von dem Pfadt zu den Heiligenstücken jn
der Rispach, den Weg hinaus als man ghein Schlirf gehet...". Im
Kopeibuch Ad.
Hermann Riedesel steht statt "Heiligenstücken" "heilig Slagborn in
der risbach".
- 1531 heißt es bei der Landscheidung des Gerichtes Stockhausen
"hinein bis in die Danckerode bei dem alten Schlage".
- Um 1530 im Rechtsstreit des Klosters Blankenau gegen die
Riedesel wird nach den Fuldischen Akten ausgesagt, daß die Wüstung
mit Grund und Boden dem Kloster Blankenau gehöre und von Hainzell aus
bestellt werde, in Besitz genommen und Wiesen daselbst um Zins dem
Schultheiss zu Schlechtenwege eingegeben haben.
- 1534 siehe Vorgeschichte.
- 1556 wird Dankenrod als Wüstung im Gericht
Herbstein genannt.
- Im Altfelltal, nicht in einer Talweitung, sondern in einer Talenge
lag zwischen Stockhausen und Schlechtenwegen unweit der
mittelalterlichen Fernverbindungsstraße, des Ortesweges, die Siedlung
Dankenrod. Die Auswahl dieses Ortsplatzes und der in einer Windung des
Baches sich erhebende, von Menschenhand geschaffende Hügel, der auch auf
dem Meßtischblatt mit der Höhe 351 m eingezeichnet ist, lassen auf eine
wehrhafte Gründung schließen. Im Volke erzählt man sich von einer Burg
der Herren von Dankenrod, die auf einem Hügel gestanden haben soll.
Wahrscheinlich hat es sich um einen befestigten Hof gehandelt,
vielleicht um die 1337 genannte "Hofstadt uffm Hagen". Außer
dieser für jeden sofort sichtbaren Bodenveränderung, erkennt das
geschulte Auge auch die unscheinbaren Hinterlassenschaften von drei
weiteren Gebäuden am rechten Bachufer: Reliefstörungen (erhöhte,
rechteckige Hangverebungen), Funde von Scherben und Hüttenlehm, sowie
auffallend schwarze Erde. Auch der Hügel zeigt in den Maulwurfshaufen
Hüttenlehm und Topfscherben und nur dürftigen Graswuchs. Das 30 m
östlich des Hügels gelegene Gebäude hinterließ besonders viel Hüttenlehm
und Eisenschlacken. Diese und stark verrostetes Eisen am Bachufer sind
das einzigen Zeugnis einer ehemaligen, mit dem Orte verbundene
Eisenschmelze.
- Das hier ermittelte Phosphatprofil zeigt hohen Phosphatgehalt an und
auf dem Küppel, während sich das übrige Gelände neutral verhält, ja der
tiefste Phosphatgehalt liegt innerhalb des Eisenschlackenrechtecks. Dies
alles spricht für die von Lorch entwickelte Methode. Die Tatsache aber,
daß auch das linke, flachgründige Steilufer, das wohl immer außerhalb
menschlichen Wirkens gelegen hat, erhöhten Phosphatgehalt zeigt,
bestätigt den Schluß, daß dieser dort erhöht ist, wo der Boden nur
geringe Tiefe aufweist (wie an und auf dem Küppel) und dort besonders
niedrig ist, wo er sehr tiefgründig ist (am linken Fuß des Küppels und
in dem Eisenschlackenrechteck).
- Die Feldflur des Dorfes Dankenrod ist Acker und Wiesenland
geblieben. Nach der Zerstörung des Ortes wurde sie - wie wir aus der
Urkunde aus dem Jahre 1534 ersahen - zuerst von dem 3½ km
entferntliegenden Hainzell aus bestellt, denn hier saßen ebenso wie
einst in Dankenrod Blankenauer Untertanen. Sie hatten auf dem Ortesweg
eine gute Anfahrtstraße zu diesen entlegenen Feldern. Die
Riedesel aber zogen die Wüstung in ihr Gebiet und belehnten damit
Bauern aus näher gelegenen Dörfern: aus Schlechtenwegen und Stockhausen.
So waren die Verhältnisse natürlicher und so haben sie sich bis heute
erhalten: Die Feldflur der Wüstung Dankenrod ist aufgeteilt an die
Gemarkung Schlechtenwegen und Stockhausen und wird von dort aus immer
noch bestellt.
Rissbach
- 1312 Mechthildis, die Witwe Trabothos von Eisenbach, schenkte
mit Einwilligung ihrer Söhne, Tochter und Schwiegersohn ihr Dorf Rispach
und den Berg Rischberg dem Kloster Blankenau.
- 1338 Eckehard von Bymbach und Adelheid seine Ehefrau
verkaufen dem Kloster Blankenau ihr Dorf Risbach für 270 Pfund Heller.
- 1340 Theodoricus Probst, Elizabeth Äbtissin in Blankenau und
der ganze Konvent der Nonnen daselbst bekunden, daß der Ritter
Friedericus von Hirtzesberg seiner Schwester Gertrudis, die als Nonne im
Kloster lebt, 30 Pfund Heller und 3 Pfund Talente jährlich im Dorf
Rispach für ihre privaten leiblichen Bedürfnisse gekauft hat.
- 1383 Metze von Lisberg vertauscht zwei Güter zu Oberndorf und
eines zu dem Gundolfs gegen Else von Merlaus beiden Güter in Dankenrod
und "eyne halbe moln stat, die czise Fischern zu Rispach inne hat"
- 1405 "Das Fischwasser die Nente genannt, zwischen Dankerode
und Risbach". Siehe Dankenrod.
- 1502 belehnt Probst Eberhard von Blankenau Stockhäuser
Einwohner mit zwei Gütern zu Rispach gelegen.
- 1524 Siehe Dankenrod.
- 1534 Siehe Vorgeschichte.
- Gehen wir von Schlechtenwegen das Altfelltal abwärts, so kommen wir
unterhalb Dankenrod in die Balswiese, welche in Jahre 1405 "in
dem Paltz" heißt und zwischen Dankenrod und Risbach lag. Risbach hat
demnach unterhalb Dankenrod am Prinzenbach gelegen, südöstlich dem zu
diesem Dorf gehörigen Reißberg. Hier heißt die Flur an der
Schlechtenweger-Stockhäuser Grenze "am Forellenteich" und stößt an der
Schlechtenweger Flur "in der Risswich". Risswich ist der mundartliche
Name für Rissbach (Rissbach-Rissbich-Risswich) und bezeichnet heute die
Lage der ehemaligen Rissbacher Flur, während der Ort etwas abwärts am
Prinzenwasser gelegen hat. Im Jahre 1848 kannte man dort noch den
Namen "Rissbach", der heute vergessen zu sein scheint (Stockhäuser
Kirchenchronik, Pfarrer Gustav Landmann).
Gersdorf (Gerwigesdorf)
- 1323 wird Gerwigesdorf genannt.
- 1324 Heinrich VI, Abt von
Fulda
bestätigt dem Kloster Blankenau die diesem von seinen Vorgängern
gemachten Schenkungen in Richolffs, Rixfeld, Burghards, Salzschlirf,
Kirchstockhausen, Gerwigesdorff (in der Überschrift der Urkunde steht
statt dessen "Gerstorff"), Dankerode, Borsa und Eichenau.
- 1515 leiht der Probst zu Blankenau dem Manne Kuntzen,
wohnhaft zu Stockhausen, des Klosters ganzes Gut zu Gerßdorff gelegen,
genannt das Fliederenerß Gut mit aller seiner Zugehörung.
- 1534 siehe Vorgeschichte
- Unterhalb Stockhausen befindet sich am südwestlichen Fuße des
Kirchberges nahe einer Quelle die Flur "am Gersters". Dieser Name ist
der letzte Rest des Dorfes Gersdorf, dessen terrassierte Äcker heute im
engsten Bereich des Stockhäuser Ackerlandes liegen. Hier haben wir nur
eine Ortswüstung vor uns. Es ist daher auch erklärlich, daß sich von dem
eigentlichen Dorf kaum Reste erhalten haben.
Bedelsdorf (Bettelenstokhusen)
- 1274 heißt es unter einer Überschrift "Bettelsdorf": nostrum
mediatent ville, quae vulgari nomine Bettelenstokhusen appelatur ..."
- 1534 siehe Vorgeschichte.
- Bettelenstokhusen wurde im Gegensatz zu Kirchenstockhausen, dem
heutigen Stockhausen so genannt. Später schliff sich der Name zu
Bedelsdorf ab. Keiner der beiden Namen hat sich in einer Flurbenennung
erhalten, keine Urkunde gibt uns Auskunft über die evtl. Lage des Ortes.
- Andererseits aber haben wir unterhalb von Stockhausen einen der
markantesten wüsten Ortsplätze – und für diesen keinen Namen.
- Dieses Beispiel beleuchtet am besten, wie wichtig die Flurnamen zur
Lokalisierung der Wüstungen sind. Kaum ein Viertel der bisher genannten
hätten wir ohne dieselben im Gelände wiederfinden können.
- In einem Altfell-Mäander liegt unterhalb von Stockhausen ein wüster
Ortsplatz auf einer stark erhöhten Wiese, der sogenannten "Hauswiese".
Da in diesem Gebiet die Lage einer anderen Wüstung unbekannt ist und der
Name "Hauswiese" evtl. noch von Bettelenstokhusen herrühren kann, so
nehmen wir an, daß dieses Dorf hier gestanden hat (der Name "Hauswiese"
kann auch bezeugen, daß hier ein festes Haus = bedeutender Hof gestanden
hat). Auch liegen daran anschließend die "Stockackerwiesen". Bedelsdorf
scheint demnach das ausgegangene Dorf zu sein, dessen Ortslage wir
verhältnismäßig gut rekonstruieren können.
- Mit Hilfe der Funde in der vorhandenen Aufschlüssen (Bachufer,
Bewässerungsgräben und Maulwurfhaufen) lassen sich auf der 250X120 m
großen Wiese die Rechtecke von mindesten 6 Hausstellen erkennen. Genau
an diesen 6 Stellen konzentrieren sich die Funde von Hüttenlehm,
Tongeschirrscherben und Holzkohlen. Die einzelnen Häuser haben kein
besonders verändertes Bodenrelief hinterlassen, es war auch nicht nötig,
ihren Untergrund gegen Feuchtigkeit zu erhöhen, da der gesamte, von drei
Seiten vom Bach umflossene Wiesenkomplex 1-1,70 m über denselbst
emporsteigt.
- Das südwestliche Bachufer, dessen Prallhang eine Höhe von 1,70 m
hat, zeigt uns in einzigartiger Anschaulichkeit, wie der Boden
beschaffen ist, der unter solchen Stellen liegt, an denen
Maulwurfshaufen Siedlungsrelikte enthalten. Der Maulwurf kann nur
leichte Sachen (z.B. Tonscherben) in die Höhe schaffen. Demnach muß auf
der alten, im Boden verborgenen, ehemaligen Oberfläche noch mancher
größere Gegenstand erhalten sein. Dieses bestätigt uns - ohne jede
Grabung - der oben beschriebene Altfellprallhang der Stockhäuser
"Hauswiese". Bei jedem Hochwasser werden von dem Steilufer leichte
Bodenbestandteile fortgerissen. Alle festen Bestandteile bleiben dagegen
zunächst noch herausragend im Erdreich stecken. So sehen wir hier in 60
cm Tiefe einen 10 cm dicken Holzkohlehorizont, über den die Bruchstücke
von Hausgerät verstreut sind. Unter demselben aber liegt unberührter
Mutterboden. Nach oben, zur heutigen Bodenoberfläche hin, nehmen die,
den Boden anfüllenden Fremdkörper an Häufigkeit ab, doch finden sich
Einzelstücke bis unter die Oberfläche - bis in die Maulwurfshaufen auf
derselben. Ursprünglich lagen sie alle direkt auf der Schicht verkohlten
Holzes. Die heute über derselben liegende 60 cm dicke
Aulehmablagerungsschicht ist ein Naturwerk der letzten 480 Jahre! Durch
die Arbeit der Tiere (vor allem der Maulwürfe) und in geringem Maße auch
durch die Arbeit des Sickerwassers wurden die Fremdkörper aus ihrer Lage
gebracht und langsam nach oben transportiert. Die Masse aber liegt etwa
noch an ihrem alten Platz. Dazu gehören vor allem die größeren
Topfstücke, die man, wenn man Glück hat, schon aus der beschriebenen
Bachwand herausholen kann.
- Das auf diese Weise gefundene Material ist sehr reichhaltig und geht
in seinen ältesten Stücken bis in die
Karolinger Zeit zurück. Das meiste ist hochmittelalterliches
Material. Die Fundstelle 2 unserer Zeichnung ist neben Hüttenlehm durch
auffallend viele Eisenschlacken gekennzeichnet, die vermutlich die Reste
einer hier am Wasser gestandenen Eisenschmelze sind.
- Wie wir oben sahen, wurde Bedelsdorf, das Blankenau Untertan war, in
den Kriegsläuften der 60er Jahre des 15. Jahrhunderts zerstört und nicht
wieder aufgebaut. Die Feldflur aber, als das Element, das sich länger
erhält, ist noch heute unterhalb des Kirchberges als solche in
Benutzung.
Niederndorf
- Vom Niederndorf, das Blankenauer Besitz war, wissen wir, daß es
gleichfalls zu den in der bekannten Fehde zerstörten Orten gehört. Es
lag am Wasser des Eulrichsborns, das unterhalb des Landenhäuser Steines
entspringt. Später wurde die Wüstung wieder mit einem Hof besetzt, der
dort noch heute steht. Sie hat aber vorher lange wüst gelegen und ist
auch nur zum Teil wieder aufgebaut. Während der Ort heute als temporäre
und partielle Wüstung in Erscheinung tritt, ist die Feldflur zum größten
Teil verfallen. Die Niederndorfer Flur lag weit ab von Stockhausen und
so ist es erklärlich, daß sich diese umgesiedelten Bewohner von
Stockhausen aus bald andere Felder suchten. Es gab genügend näher
gelegene wüste Äcker, die sie roden konnten. Heute ist die Flur nur noch
nach Bedelsdorf-Stockhausen offen. Das vom Eulrichsborn herabsteigende
Wiesental trägt zu beiden Seiten wieder Wald.
- Die an den Hängen des Bundsandsteins liegende Siedlung hat
vermutlich auch Töpferei betrieben, wie der Name Eulrich (Euler-Töpfer)
bezeugt. Es entspräche dies den übrigen Wüstungen der
Bundsandsteinerhebungen, die auch als totale Wüstungen vor uns liegen,
weil die Feldflur allein die Bestellung nicht lohnt.
Zusammenfassung
- Soweit kennen wir die Wüstungen des Stockhäuser Grundes. Sie sind
wegen der günstigen Lage des gesamten Raumes (verhältnismäßig lange
Vegetationsdauer) zum großen Teil nur Ortswüstungen, ihre Felder werden
noch bearbeitet.
- Leider ist uns keine Aufzählung der im Mittelalter zum Gericht
Stockhausen gehörigen Orte erhalten. Ob uns die Blankenauer Klageschrift
aus dem Jahre 1534 alle Wüstungen nennt, können wir daher nicht
entscheiden. Es könnten auch noch andere Dörfer hier gelegen haben, in
denen das Kloster keine Rechte zu verlieren hatte. Ihrem Wiederaufbau
hätte allerdings von herrschaftlicher Seite nichts im Wege gestanden.
Die Bewohner blieben evtl. aber auch gleich den Blankenauer Untertanen
in Stockhausen wohnen, wohin sie während der Fehde geflüchtet waren.
Ohne
Riedeselsche Anregung und Vergünstigung unterblieb daher der
Wiederaufbau.
- Aus Mangel an urkundlichem Material kann daher nicht entschieden
weden, ob der heutige Hof Vietmes, der in der 2. Hälfte des 16.
Jahrhundert nach einem
Riedeselschen Bericht "vor wenig Jahren noch Holz und Wald war",
eine völlig neue Rodung oder die Neubesetzung einer solchen
Riedeselschen Wüstung darstellt. Besonders beachtenswert ist die
auffallende Linienführung der Schlechtenweger - Stockhäuser
Gemarkungsgrenze, die zeigt, daß Vietmes als Südzipfel an der
Gemarkung Stockhausen angehängt ist.
- Wenn auch die Bewohner der zerstörten Orte das Land von Stockhausen
aus weiter bestellten, so ergaben sich dabei doch manche Änderungen. Es
verödeten nicht nur die an der Peripherie liegenden Teile der
Niederdörfer Flur, sondern es lagen auch Stockhäuser Äcker lange Zeit
wüst und wurden nur langsam wieder aufgeräumt, ein Zeichen dafür, daß
die Bevölkerung stark abgenommen hatte. Manche Teile verwaldeten auch
wieder völlig.
- Im Staatsarchiv zu
Darmstadt befindet sich eine Streitakte der
Riedesel untereinander aus dem Jahre 1573.
Hermann Adolf Riedesel hatte demnach einige bei Stockhausen liegende
wüste Äcker roden und einsäen lassen. Die wüsten Äcker waren an die
Herrschaft zurückgefallener Besitz und gehörte allen
Riedeseln zu Eisenbach gemeinsam. Daher verlangten die Vettern
Hermann Adolf Riedesels einen Anteil an dem Ertrag solcher
aufgeräumten Äcker. Auch waren sie erbost, daß er den daneben liegenden
Eichenwald zu roden begann.
Hermann Adolf Riedesel verweigerte ihnen dagegen jegliche Abgaben,
da sie, wie er meinte, sich ja selbst die Mühe machen könnten, dort
solche Äcker zu roden. Daraus entnehmen wir, daß zu dieser Zeit um
Stockhausen größere Ackerflächen wüst lagen. Damit wird auch das
Bestreben der
Riedesel zusammenhängen, die Bewohner der umliegenden Blankenauer
Dörfer nach der
Steinschen Fehde in Stockhausen festzuhalten, denn sie sollten ja
"dort bauen".
- Die Besiedlung des Stockhäuser Grundes war nicht allein auf Ackerbau
eingestellt. Bei Dankenrod und Bedelsdorf sahen wir schon, daß auch
Eisenindustrie eine Rolle spielte. Besonders die Waldschmieden von
Stockhausen und Schadges scheinen für ihre Zeit große Unternehmungen
gewesen zu sein. Die Stockhäuser Schmiede, die oberhalb des Ortes bei
der heutigen Schlagmühle gestanden hat (Flurname "Schmittwiesen"), soll
bis nach
England geliefert haben (auf dem Weg über Ortesweg -
Frankfurt?). Die Schadgeser Schmiede stand unterhalb des Ortes im
Tal in den "Schmiedswiesen".
- Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß vor der
Reformation im Stockhäuser Walddistrikt " Heilig Kreuz" eine
Kapelle stand. In einem Zeugenverhör des Jahres 1616 sagte ein
Zeuge aus, daß man den Mauerschädel (Ruine) "Heilig Hauk" jetzt "Heilig
Kreuz" heiße. Ein anderer sagte aus, daß das alte Steingeröll dort von
der Kapelle "zum Heiligen Kreuz" sei.
Weblinks
SV Stockhausen eV *[1]
Spar- u. Darlehnskasse Stockhausen eG *[2]
Quellenangaben
- Stockhäuser Geschichte(n) von Hans-Heinz Link
- Geschichte der Wüstungen (Gertrudt Mackenthum Die Wüstungen des
Altkreis Lauterbach 1948 )
- Festschrift zur 150-Jahrfeier des Kindergartens und Wiedereinweihung
am 6. Oktober 1991
- Festschriften Stockhäuser Vereine
- Festschrift der Spar-und Darlehenskasse Stockhausen
|
|